Schon sechs Jahre ist es her, dass die Krim von Russland annektiert wurde. Wie hat sich dieses Ereignis auf die beiden Gesellschaften ausgewirkt?
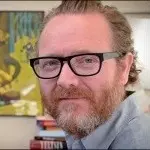
Graeme Robertson: Die Annexion der Krim hat sich auf die russische Gesellschaft grundlegend und nachhaltig ausgewirkt. Die bekannteste Folge war, dass die Popularität von Präsident Putins langfristig in die Höhe schnellte. Doch die Auswirkungen waren tiefgehender:
Beim Vergleich unserer davor (im Oktober 2013) und danach (im Juni 2014) durchgeführten Umfragen ist in der russischen Gesellschaft eine veränderte Wahrnehmung ihres Präsidenten festzustellen. Nicht nur die Zustimmungswerte für ihn stiegen, sondern auch das Vertrauen, die Hoffnung und der Stolz, die davor sehr gering waren. Spannenderweise legen die empirischen Daten nahe, dass die Russen nicht nationalistischer geworden sind. Viel eher entspricht ihre Bewertung des eigenen Landes jetzt mehr dem bereits bestehenden hohen Maß an patriotischen Gefühlen.
Während der soziale Konsens nach der Krim-Annexion immer überhöht dargestellt wurde, schien die Blase um Wladimir Putin 2018 mit der Ankündigung der unbeliebten Rentenreformen zu platzen. Im weiteren Verlauf des Jahres war die Stimmung in der russischen Gesellschaft immer mehr vom Vertrauensverlust in die Behörden und zunehmenden wirtschaftlichen Sorgen geprägt. Allerdings scheint sich das wieder stabilisiert und im letzten Jahr sogar etwas verbessert zu haben. Dennoch spricht eine Rekordzahl von Russen von dem Gefühl, die Interessen der Gesellschaft würden denen des Staates entgegenstehen. Diese widersprüchlichen Empfindungen spiegeln eine Kombination aus Patriotismus und Mangel an politischen Alternativen wider, der einen großen Teil der Bevölkerung von politischen Prozessen fernhält.

Gwendolyn Sasse: Die Annexion der Krim hat weitreichende Konsequenzen für den Staat und die Gesellschaft in der Ukraine. Die Verbindungswege über Land zwischen der Ukraine und der Krim sind extrem erschwert, doch wurden in vielen Fällen auch andere Arten von Verbindungen zwischen Freunden und Familienmitgliedern gekappt. (Siehe Umfrageergebnisse)
Durch die Annexion der Krim entstand auch ein Raum für die Mobilisierung der von Russland unterstützten Separatisten im Donezbecken und den anschließenden Krieg, der bereits über 13.000 Menschen das Leben gekostet und 2,5 Millionen ukrainischer Bürger in die Flucht getrieben hat (davon 1,5 Millionen Binnenvertriebene und etwa eine Million Flüchtlinge in Russland).
Für die Binnenvertriebenen brachte das eine Stigmatisierung und politische Entmündigung mit sich. Etwa 40.000 Menschen, darunter viele Krimtataren, sind von der Krim in andere Teile der Ukraine, unter anderem die Westukraine, gezogen und haben damit zur gesellschaftlichen Vielfalt des Landes und zu einer Bewusstseinsbildung über das historische und derzeitige Schicksal der Krimtataren beigetragen.
Die ukrainische Politik und Gesellschaft werden im Wesentlichen davon bestimmt, dass sich das Land im Krieg befindet. Krieg erfordert Ressourcen und Prioritätensetzung, darunter erhebliche Investitionen in das ukrainische Militär. Und Krieg verträgt sich nicht besonders gut mit umfassenden Strukturreformen.
Viele Beobachter sprechen von einem „Krim-Konsens“ in Russland. Was genau bedeutet das? Und gibt es ein vergleichbares Phänomen in der ukrainischen Gesellschaft?
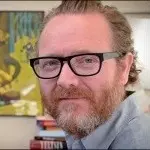
Graeme Robertson: Nach der anfänglichen Begeisterung konsolidierte sich die russische Politik derart, wie es zuvor noch als unwahrscheinlich galt. Der so genannte Krim-Konsens bestand aus mehreren Komponenten. Er war die Übereinkunft der Elite darüber, dass Russland eine umkämpfte Festung sei, das Bollwerk traditioneller Werte gegen den dekadenten Westen und der Beschützer von Russen und russischsprachigen Menschen im Ausland.
Die russische Führung hatte dieses Ziel bereits vorher verfolgt, aber die Krim änderte die Situation in zweierlei Hinsicht: Erstmals seit dem Kalten Krieg errangen Präsident Putin und seine Entourage einen wichtigen strategischen Sieg über den Westen, und das Bild vom ausländischen Feind erleichterte es, Kritik am Regime als Verrat hinzustellen. Die Einstellung gegenüber der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten kippte nach der ukrainischen Revolution der Würde entschieden ins Negative und erholte sich laut der Umfrageergebnisse des Lewada-Zentrums erst 2018. In Kombination mit umfangreicher Medienzensur trug diese Atmosphäre dazu bei, dass Kritik an Russlands anhaltend schlechter Wirtschaftsleistung ausgeblendet wurde.

Gwendolyn Sasse: Die Annexion und der Krieg in der Ostukraine haben in der ukrainischen Gesellschaft die Selbstidentifizierung mit dem Staat verstärkt. Externe Beobachter neigen dazu, die Identitäten und die Politik in der Ukraine auf eine Spaltung zwischen Ost und West zu reduzieren, die an ethno-linguistische Differenzen gekoppelt ist. Diese Wahrnehmung war schon immer irreführend und in der von Annexion, Krieg und Vertreibung geprägten Zeit sehen wir eine interessante Entwicklung hin zu einer noch stärkeren staatsbürgerlichen und bilingualen Identität.
In dieser Hinsicht ist die Ukraine für breit angelegte vergleichende Studien zum Thema Krieg ein bemerkenswerter Fall, denn im Gegensatz zu anderen Kriegen wurden hier viele Umfragedaten während des Krieges erhoben, auch von unmittelbar Betroffenen, und nicht erst danach.
In der Ukraine herrscht Konsens darüber, dass die Krim ukrainisch ist. Ich vermute, dass sich das nicht ändern wird, obwohl mir keine empirischen Daten bekannt sind, die diese Frage unter die Lupe nehmen. Die Annexion der Krim und der Krieg in der Ostukraine haben die pro-westliche Orientierung der ukrainischen Außen- und Innenpolitik und die gesellschaftliche Forderung nach einem „normalen“ europäischen Staat verstärkt.
Die Annexion der Krim durch Russland und der anhaltende Krieg im Südosten der Ukraine haben, milde ausgedrückt, die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern langfristig zerrüttet und einen Keil zwischen die Gesellschaften getrieben. Angenommen, die Krim bleibt dauerhaft Teil Russlands, gibt es die Möglichkeit einer erneuten Annäherung?
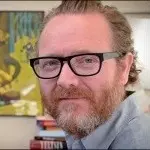
Graeme Robertson: Auf der russischen Seite ist die Schwelle zu einer Wiederannäherung niedriger, da Russland gesündigt hat, und nicht die Ukraine. Andererseits hat weder die russische Führung noch die Mehrheit der Bevölkerung Lust, sich zu entschuldigen. Dennoch gibt es Lichtblicke. Die Einstellung zur Ukraine hatte sich in Russland nach der Krim drastisch ins Negative gewendet, aber in den letzten Monaten tendiert sie wieder zum Positiven.
Doch entscheidender ist vielleicht der starke Wunsch nach einer Normalisierung der Beziehungen mit Europa und den USA, der Russland verhandlungswillig stimmt. Aber in den Verhandlungen kann es wahrscheinlich nur einen begrenzten Spielraum geben. Es ist schwer, sich ein Abkommen vorzustellen, bei dem Russland die Kontrolle über die Krim abgibt, solange Putin an der Macht ist. Unter Umständen wäre eine Machtteilung denkbar, wobei dafür wiederum der politische Preis für Kiew enorm hoch wäre.

Gwendolyn Sasse: Jede Wiederannäherung kann nur einseitig und unbeständig ausfallen, solange die Krim nicht wieder in den ukrainischen Staat eingegliedert wird. Sogar einer teilweisen Wiederannäherung müsste das Ende des Krieges im Osten des Donbass vorangehen. Das liegt derzeit in weiter Ferne, ist im Prinzip aber nicht unmöglich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Wahlkampf darauf aufgebaut, dass er den Krieg beenden will, und seine Verhandlungsbereitschaft demonstriert. Deswegen hängt viel davon ab, ob Moskau den politischen Willen entwickelt, auf einen langfristigen Waffenstillstand, eine Entmilitarisierung und eine Reintegration der so genannten Volksrepubliken in den ukrainischen Staat hinzuarbeiten. Davon ist derzeit nichts zu sehen. Die geplanten Änderungen der russischen Verfassung enthalten das Verbot, Russlands territoriale Integrität in Frage zu stellen. Auf diese Weise wird die Diskussion über die Krim mit Russland unterbunden, bevor sie überhaupt erst aufkommen kann.
Interessanterweise unterscheiden die Menschen in beiden Ländern zwischen dem Verhalten des Staates und der Bevölkerung des jeweils anderen Landes. Außerdem hat der anfängliche Anstieg der negativen Ansichten über das Nachbarland in beiden Ländern wieder abgenommen. Ukrainische und die russische Meinungsumfragen vom Herbst 2019 zeigen, dass die Mehrheit der Ukrainer und der Russen ihr Nachbarland wieder im positiven Licht sieht. Diese Mehrheitsmeinung hat sich in der Ukraine demnach schneller wieder eingestellt als in Russland.
Wird die Krim jemals wieder Teil der Ukraine sein?
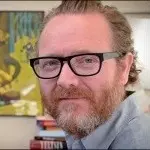
Graeme Robertson: Es ist schwer, sich eine komplette Rückkehr der Souveränität unter Wladimir Putin vorzustellen. Dann wäre da noch die Frage, was die Menschen auf der Krim selbst davon hielten. So lange Russland wirtschaftlich stärker ist als die Ukraine, bleibt es schwer, eine Politik der Rückkehr umzusetzen. Aber trotz alledem: In den letzten 30 Jahren habe ich gelernt, dass in der Politik das Unerwartete zu erwarten ist. Sag niemals nie!

Gwendolyn Sasse: Es würde einen maßgeblichen politischen Wandel in Russland erfordern, sowohl auf der Ebene der Eliten als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Kurz- oder mittelfristig ist das nicht sehr wahrscheinlich. In der Zwischenzeit müssten in der Ukraine die Lebensqualität und die politischen Freiheiten so ansprechend gestaltet werden, dass die Krimbewohner motiviert sind, von sich aus den Prozess voranzutreiben. Die ukrainische Politik sollte sich aktiv darum bemühen, die Verbindung zur Bevölkerung auf der Krim aufrechtzuerhalten, anstatt nur gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass die Krim Teil der Ukraine sei. Sie sollte dem offiziellen russischen Narrativ ein eigenes politisches Narrativ als Alternative entgegenstellen sowie die Zugangsbeschränkungen von ukrainischer Seite aufheben, um nationale und internationale Berichterstattung zur Entwicklungen auf der Krim zu fördern. Das würde der Ukraine kleine Schritte in die richtige Richtung ermöglichen.
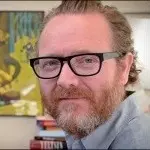
Graeme Robertson ist Professor für Politikwissenschaft an der University of North Carolina in Chapel Hill und Direktor des Zentrums für Slawische, Eurasische und Osteuropäische Studien. Seine Arbeit konzentriert sich auf politischen Protest und Regimeunterstützung in autoritären Regimen. Robertsons neues Buch (mit Samuel A. Greene), Putin v. The People, ist im Juni 2019 bei Yale University Press erschienen. Es bietet einen neuen Blick auf die gesellschaftlichen Grundlagen der Unterstützung und Ablehnung autoritärer Herrschaft in Russland.

Gwendolyn Sasse ist Wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) in Berlin und Professor of Comparative Politics an der Universität Oxford.
